nach einer Diskussion mit meinem 16jährigen Sohn stellt sich mir die Frage, wie unterscheiden sich die Leistungsangaben von Verstärkern bzw. Boxen eigentlich? Ich selbst bin aufgewachsen mit Sinus-Leistung (nach DIN 45500) und Musikleistung, die seinerzeit schon eine nicht richtig nachvollziehbare Größe darstellte. Heute dagegen wird in "Watt max" und "R.M.S." angegeben, was eine Box verkraftet, bzw. ein Verstärker ausspuckt. Gibt es da eigentlich einen nachvollziehbaren bzw. reproduzierbaren Zusammenhang zwischen diesen Größen?
Viele Grüße aus dem nebligen Niedersachsen
Harald


 ) Marantz 2270 wurde angegeben mit 2x70 Watt RMS, nach DIN wurden aber mehr als 100 Watt je Kanal gemessen. Eine sehr nette Beschreibung dazu gibt's in der
) Marantz 2270 wurde angegeben mit 2x70 Watt RMS, nach DIN wurden aber mehr als 100 Watt je Kanal gemessen. Eine sehr nette Beschreibung dazu gibt's in der 

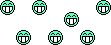

Kommentar